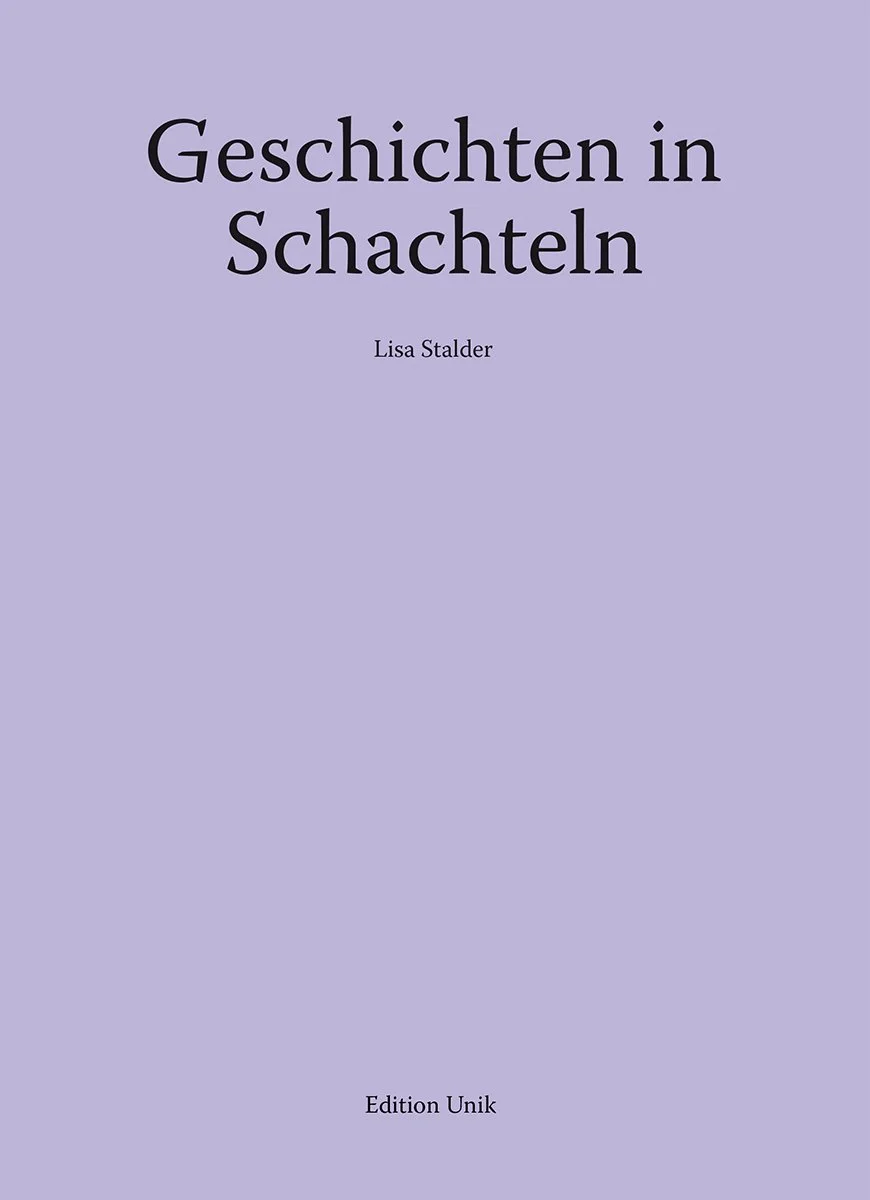Prolog & Die Wohnung
aus: Lisa Stalder, Geschichten in Schachteln
Prolog
Bis Ende Monat muss die Wohnung geräumt sein.
Während 43 Jahren hat deine Mutter in dieser Wohnung gelebt. Den grössten Teil davon zusammen mit deinem Vater, ehe er vor ein paar Jahren starb. Plötzlich. Ohne Ankündigung. Von einem Tag auf den andern. Nun muss deine Mutter die Wohnung verlassen. Nicht freiwillig. Die Besitzerin, eine Pensionskasse, plant eine Totalsanierung. Diese sei bitter nötig, hatte Herr Schneider von der Verwaltung, ein dicklicher, kleiner Mann mit Glatze, an der Informationsveranstaltung gesagt, schliesslich lägen die letzten grösseren Renovationsarbeiten nun auch schon über 20 Jahre zurück. Küche und Bad seien nicht mehr zeitgemäss, die Raumaufteilung lasse zu wünschen übrig und der Balkon, sagte der Verantwortliche und verwarf die Hände, der Balkon sei gemeingefährlich. So dürfe heute nicht mehr gebaut werden. Deshalb sei eine ganzheitliche Vorgehensweise zwingend nötig. Da verstehe es sich von selbst, dass das Haus während des Umbaus nicht mehr bewohnt werden könne. Aber, sagte Herr Schneider auch, man werde allen Bewohnerinnen und Bewohnern dabei helfen, eine neue Bleibe zu suchen, falls sie das denn wünschten. Und er habe noch eine weitere gute Nachricht: Die derzeitigen Mieterinnen und Mieter hätten selbstverständlich Vorrang, wenn es dereinst darum gehen werde, die sanierten Wohnungen neu zu besetzen. Sanierte Wohnungen, die das Doppelte kosten werden. Das hatte Herr Schneider natürlich nicht gesagt. Aber ihm war klar, dass es alle im Raum wussten.
Deine Mutter hatte sich an der Veranstaltung fürchterlich aufgeregt. Weniger wegen der Ankündigung, dass sie ihr langjähriges Zuhause verlassen muss. Dieser Schritt stand ihr sowieso bevor, hatte sich ihre Gesundheit in den letzten Jahren doch verschlechtert. Es war vielmehr die Aussage, dass seit so langer Zeit nichts mehr gemacht worden sei. Immer wieder hatte sie sich an die Verwaltung gewendet, zum Beispiel, als sich die Temperatur ihres Backofens nicht mehr regulieren liess oder als sie einen Riss in der Wand entdeckte. Sie dürfe den Backofen einfach nicht mehr zu heiss einstellen, hiess es damals. Und der Riss sei nur in der Tapete und somit keine grössere Sache. Oder damals, vor der letzten grossen Renovation, als sie gefragt wurde, ob sie irgendwelche Sonderwünsche habe. Sie, die mit ihren 1 Metern 78 Herrn Schneider von der Verwaltung um fast einen Kopf überragte, fragte, ob es allenfalls möglich sei, dass in ihrer Küche Arbeitsfläche und Herd um ein paar Zentimeter nach oben versetzt würden. Ihr Rücken schmerze immer, wenn sie länger in der Küche arbeite. Herr Schneiders Antwort: «Gute Frau, wir bauen nicht für Sie um, sondern für jene, die nach Ihnen in die Wohnung einziehen werden.»
Nun wird also niemand mehr in ihre Wohnung einziehen.
Die Wohnung
Du stehst im Entrée und atmest tief ein. Es riecht nach Nina Ricci Eau de Toilette. Jenes Eau de Toilette, das sich deine Mama seit Jahren an den Hals sprayt, bevor sie das Haus verlässt. Seit ihr Geruchssinn nicht mehr so gut funktioniert, sind es manchmal zwei oder drei Spritzer. Obwohl du selber nichts mit Nina Ricci anfangen kannst, mit Eau de Toilette im Allgemeinen, ist es für dich der Duft, der signalisiert, angekommen zu sein. Zuhause zu sein. Und dies, obwohl du seit Jahren nicht mehr in dieser Wohnung lebst.
Und jetzt musst du dieses Zuhause räumen. Bis Ende Monat. Und du weisst nicht, wo du anfangen sollst. Einiges hast du mit deiner Mutter bereits aussortiert. Die Vasen, die Küchengeräte, die Bettwäsche. In wenigen Tagen kommt deine Schwester aus Frankreich, sie wird sich um die Bücher kümmern. Bücher sind ihr heilig, sie wird sich nicht von vielen trennen können. Auf der Suche nach einem Anfang schreitest du langsam durch den Gang und schaust dabei in jedes einzelne Zimmer. Esszimmer, Wohnzimmer, dein ehemaliges Kinderzimmer, Küche, Bad, Elternschlafzimmer und Büro, auch das ein ehemaliges Kinderzimmer von dir. Im Büro bleibst du vor dem Büchergestell stehen und fährst mit deinem Zeigefinger am Rande eines Tablars entlang. Deine Fingerkuppe ist grau vom Staub, der sich hier angesetzt hat. Die Putzfrau war lange nicht mehr da. Das letzte Mal, kurz bevor deine Mutter ins Spital eingeliefert werden musste. Jetzt ist sie in einem Ferienbett, danach wird sie in eine Alterswohnung ziehen. Eine zwischenzeitliche Rückkehr lohnt sich nicht mehr. Und sie wäre zu kompliziert.
Du gehst zwei Schritte zum Fenster und schaust hinaus, Richtung Osten. Es ist das Zimmer mit der Morgensonne. Der Blick aus dem Fester gefiel dir indes nie. Dies aber nicht wegen der dunklen, hohen Tannen, welche die Aussicht versperrten, sondern vielmehr wegen des Nachbarhauses. Ein typischer Bau aus den 1920er-Jahren, dicke Wände, kleine Fenster, die Fassade in einem ungemütlichen Beigegrau, das grosszügige Grundstück mit einem massiven antiken Eisenzaun von der Aussenwelt getrennt. Und hinter Zaun und Mauern fand nie Leben statt. Fast nie war jemand im Garten. Gelacht wurde auch nie. Und weil ich auch hinter den weissen Vorhängen nie jemanden erkennen konntet, wart ihr als Kinder überzeugt, dass es sich um ein Geisterhaus handeln musste.
Dabei wusstet ihr, dass das Haus der Familie Studer gehört. Er, ehemaliger Arzt und Bernburger, sie, Hausfrau und Tochter aus wohlhabendem Bieler Haus. Deine Bieler Grossmutter war mit ihr zur Schule gegangen. Sie mochten sich nie. Glaubten stets, dass es die andere im Leben nie weit bringen würde. Deine Grossmutter stand auch mit weit über achtzig noch auf eurem Balkon und schaute zum Haus der Studers rüber. Noch immer verwundert, ja fast entsetzt, dass «das Kläri» tatsächlich vier Kinder zur Welt gebracht hat. «Diese dünne Gibe.» Ihr mochtet die Studers auch nicht. Sie trugen komische Kleider und grüssten nie, wenn man ihnen das eine oder andere Mal auf der Strasse begegnete.
Es hiess stets, die Familie habe unheimlich viel Geld. Doch während all die anderen Häuser im Quartier saniert wurden, liessen Studers nie etwas machen. Das Haus wirkte heruntergekommen. Und doch würde es die Familie wohl für drei Millionen Franken verkaufen können. Elf Zimmer. An dieser Lage. Aber das wird vorerst nicht passiert. Derzeit lebt noch die Tochter im Haus, sie ist inzwischen weit über 70. Sie hatte die Mutter gepflegt, bis diese vor einiger Zeit mit knapp hundert Jahren starb. Als die Mutter noch lebte, kamen die drei Brüder regelmässig zu Besuch. Heute nicht mehr. Der eine lebt in den USA, die anderen beiden in Zürich. Derjenige in den USA hat Familie, die anderen sind ledig geblieben. Im Quartier wird gesagt, die vier Geschwister hätten ein kompliziertes Verhältnis. Es werde dereinst wohl zu einem Erbstreit kommen. Es wäre nicht der erste, den das Quartier erlebt. Auch die fünf Kinder der Brandners konnten sich nicht einigen. Das Elternhaus stand während acht Jahren leer. Als der älteste Sohn starb, rauften sich die anderen vier Geschwister zusammen und verkauften das Haus. Käuferin war eine andere Nachbarin, die bereits zwei Liegenschaften im Quartier besass. Nun konnte sie endlich jedem ihrer drei Kinder eine Liegenschaft schenken. In jene von Brandners zog die Tochter, die sich in Indien in ihren Yogalehrer verliebt hatte, diesen in einer traditionellen Zeremonie heiratete und ihn mit in die Schweiz nahm. Während er nun weiter als Yogalehrer arbeitet, lässt sie sich von ihrer Mutter finanzieren und richtet das Haus alle paar Monate neu ein. Warum? Weil sie es kann. Eine ganz normale Alltagsgeschichte aus einem wohlhabenden Quartier.
Du drehst dich um und setzt dich auf den Hocker, den du vor dem Büchergestell abgestellt hast. Du solltest endlich beginnen, die Ordner nach Wichtigem zu durchforsten. Aber dir fehlt die Energie. Immer noch. Oder schon wieder? Dabei wäre dieses Zimmer ein guter Ausgangspunkt, um mit dem Räumen zu beginnen. Es ist das kleinste der ganzen Wohnung, nicht einmal 12 Quadratmeter gross. Es ist das einzige Zimmer, das noch immer einen Spannteppich hat. In allen anderen Zimmern hatten deine Eltern die Teppiche rausreissen und den alten Parkettboden freilegen lassen. Im Gang kam ein beiger Steinboden - irgendeine Art Kalkstein - zum Vorschein, Versteinerungen inklusive. Im Entrée wurde eine Muschel sichtbar, ein kleiner Gruss aus dem Mesozoikum. Als Kind hattest du mal versucht, sie mit einer Gartenhacke auszugraben. Die Muschel liess sich nicht herauslösen, stattdessen spickte ein Stück des Steins heraus, das du in der Folge mit Weissleim anzukleben versuchtest. Er klappte nur halb. Zum Glück war der Schaden nahe der Wand. So konnten deine Eltern das Telefontischchen einfach ein wenig verschieben, um deinen Versuch als Archäologin zu verstecken. Das Telefontischchen steht schon lange nicht mehr dort. Das Möbel wurde obsolet, als das Telefon mit der Wählscheibe vom schnurlosen Telefon abgelöst wurde. Jetzt steht an seiner Stelle ein Stuhl, wo sich deine Mutter jeweils ihre Schuhe anzieht. Sie kann das nicht mehr im Stehen. Im Sitzen hingegen klappt das noch gut. Aber das Aufstehen danach bereitet ihr Mühe. Das Gehirn gibt den Beinen zwar das Zeichen, dass sie sich bewegen sollen, aber diese weigern sich oft, zu tun, was von ihnen verlangt wird. Ein täglicher Kampf. Für deine Mama. Für dich kaum zu ertragen.
Plötzlich läutet es an der Tür. Du stehst auf, gehst den Gang entlang bis ins Entrée und öffnest die Wohnungstüre. Es ist Fabian, der Nachbar von gegenüber. Er habe gehört, dass du da seist. Wie es deiner Mutter gehe, will er wissen. Und ehe du antworten kannst, steht er schon im Wohnzimmer und erzählt von seiner neuen Freundin; eine Anästhesistin in einem Genfer Spital, die vor wenigen Tagen einen schweren Unfall gehabt habe. Sie sei auf dem Weg in den OP ausgerutscht, erzählt er. Er habe es kommen sehen, der Boden in diesem Spital sei einfach viel zu rutschig für diese Gesundheitslatschen, die die Ärzte und Ärztinnen während der Arbeit tragen müssten. Sie habe sich beim Sturz den Kiefer gebrochen, zwei Zähne habe sie auch verloren. Eine langwierige Sache. Und dies zum dümmsten Zeitpunkt. Er habe eigentlich mit ihr zusammenziehen wollen. Aber in diesem Zustand sei es ihr ja wohl kaum möglich, Wohnungen besichtigen zu gehen. Zudem sei ja noch gar nicht klar gewesen, ob er zu ihr nach Genf ziehen werde oder sie zu ihm. In diese Wohnung hier komme sie aber sicher nicht mehr. Das lohne sich nicht für die paar wenigen Monate, die er noch hier sein werde. Er befürchte, dass ihm nun aber der Antrieb fehlen werde, alleine auf Wohnungssuche zu gehen. Dabei steige ja auch für ihn der Druck. Inzwischen sitzt Fabian auf einem Stuhl. Ob es allenfalls noch etwas zu trinken für ihn habe, will er wissen. Am liebsten Mineralwasser mit Kohlensäure. Du gehst zum Schlüsselbrett, nimmst den Schlüssel mit dem schwarzen Anhänger und drückst ihn Fabian in die Hand: «Im Keller.»
Er verzichtet höflich und geht zurück in seine Wohnung. Fünf Minuten später steht er erneut im Entrée, diesmal mit einer Flasche Wein in der Hand. Du wirst ihm in den nächsten vier Wochen noch regelmässig begegnen. Dem Fabian.
So komisch und kompliziert er auch sein mag, Fabian war ein guter Nachbar für deine Mama. Er fragte regelmässig nach, wie es ihr gehe und ob er ihr irgendwelche Besorgungen erledigen könne. Einmal fuhr er gar mir ihr ins Ferienhaus am Bielersee, damit sie den Ölstand überprüfen konnte. Ein andermal begleitete er sie zum Arzt, weil er der Meinung war, sie sei etwas gar «gwagglig» unterwegs. Sie, im Gegenzug, liess ihn um drei Uhr in der Früh hinein, nachdem er ohne Schlüssel aus dem Ausgang zurückgekehrt war. Es war das Wochenende, an dem ihn seine Freundin, eine aufstrebende Neurochirurgin, endgültig verlassen hatte. Sie hatte sich in den Chefarzt einer Münchner Klinik verliebt, ihren Förderer. Den Schlüssel muss er in irgendeinem Club verloren haben. Dann sass er also um drei Uhr in der Früh im Wohnzimmer deiner Mutter und heulte Rotz und Wasser wegen seiner Freundin, die nun eben nicht mehr seine Freundin war. Und ein klein wenig weinte er auch wegen des Schlüssels.
Solche nächtlichen Besuche war sich deine Mutter gewohnt. Bevor Fabian in die Wohnung neben ihr gezogen war, lebte dort Frau Brunner, eine reiche, geizige Witwe, die alle paar Wochen zu sterben glaubte. Dann klingelte es an der Tür und Frau Brunner stand schluchzend und keuchend da und verlangte nach deiner Mutter. Manchmal schaute dein Vater, bevor er die Türe öffnete, durch den Spion, nur um deiner Mutter zu sagen, dass eine Kundin für sie vor der Türe stehe. Deine Mutter bot Frau Brunner jeweils an, zu ihr rüber zu gehen, um in Ruhe mit ihr zu reden. Es war dann meist Frau Brunner, die redete. Das konnte sie. Ganz besonders dann, wenn sie wieder einmal im Begriff war zu sterben. Deine Mutter gab ihr dann jeweils ein Stück Zucker, das sie in Kräuterschnaps getunkt hatte und das sich Frau Brunner auf der Zunge zergehen lassen konnte. Das Sterben war somit verschoben. Zumindest bis zum nächsten Besuch.