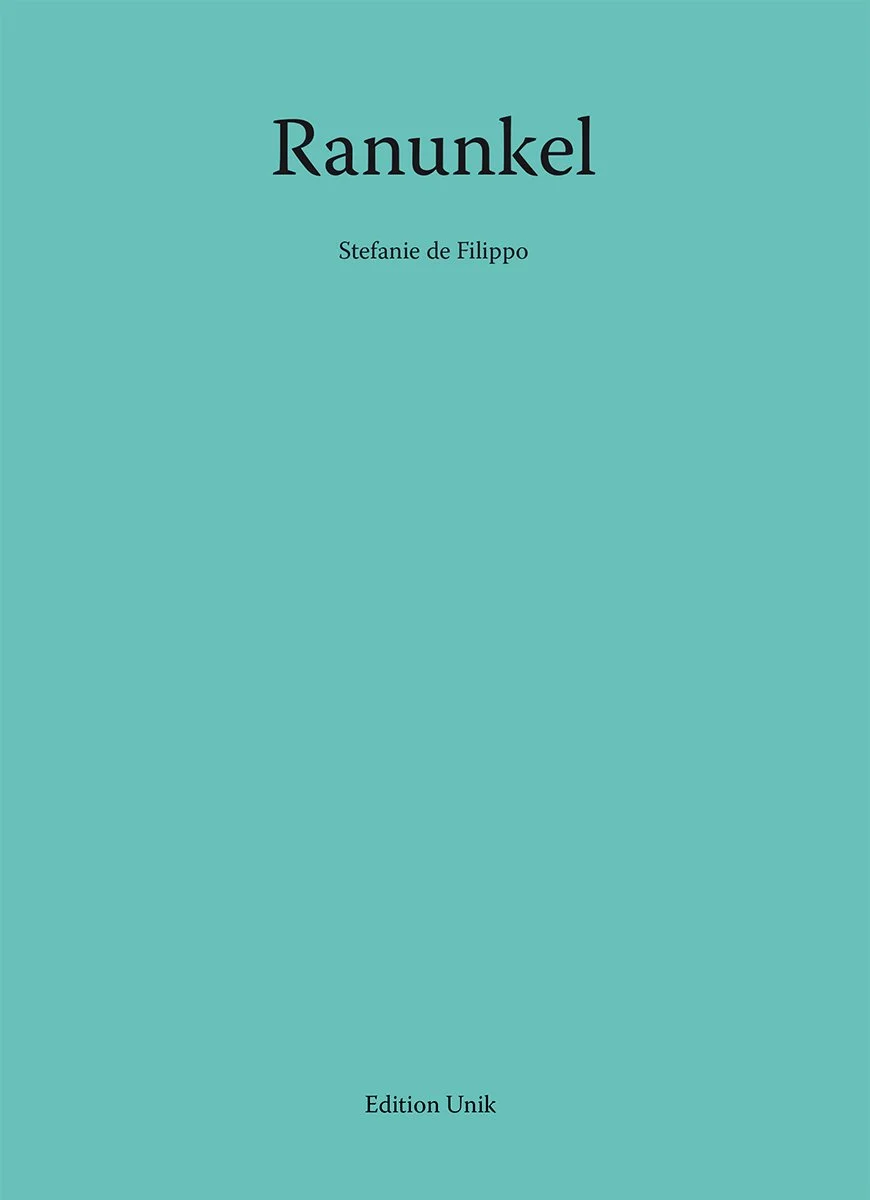Ein Drama ist auch ein Raum
Aus: Stefanie de Filippo, Ranunkel
Brodelnd meldete sich der fertige Espresso aus der Maschine auf dem Herd. Mein Blick geht zu meinem Küchentisch, zum Brief mit der schwungvollen Handschrift von Ernst.
«An Mathilda Helene Birnbaum» steht darauf. Ernst bevorzugte immer meinen zweiten Namen – Helene. Das erinnerte ihn an Helena in der griechischen Mythologie. Gerne neckte er mich damit, da ich doch meinen Erstnamen bevorzugte.
Wie bei unserem ersten Kennenlernen fällt draussen der erste Schnee und Zürich verfällt in das jährliche Chaos, als hätte es noch nie Schnee gesehen. Ich nehme mir meine Tasse und setze mich an den Tisch, um die Zeilen von Ernst nochmals zu lesen und ihm zu antworten. Meine Gedanken schweifen ab, als ich die Tasse sehe. Meine Lieblingstasse. Ein Geschenk meines Bruders, nachdem wir lange Zeit wegen eines Streits nicht miteinander gesprochen hatten. Mittlerweile hat sie einen kleinen Riss, sinnbildlich für unsere Beziehung, die voll Zuneigung ist und doch Risse hat. Ein Tropfen des Kaffees verirrt sich über eben diesen Riss auf das italienische Tischtuch, welches ich nach dem Tod meiner Schwiegermutter bekommen habe – als Erinnerung. Trotz vieler Wäschen behält es den Geruch, den auch ihre Wohnung immer hatte. Eine Mischung aus dem Geruch des Älterwerdens, auf dem Herd brodelndem Sugo, Basilikum und italienischer Seife. Das Tuch ist bereits verblichen und die Musterung erscheint nur noch schwach, so wie auch ihr Leben mit den Jahren verblichen ist.
Ranunkeln, die auf dem Tisch stehen und ihre Blätter fallen lassen, geben der Tischdecke wieder ein neues, buntes Muster. Meine Lieblingsblumen. Ihre Blütenblätter sind weich und samtig, jede Schicht eine perfekte Mischung aus Farben, die sich bei der kleinsten Bewegung des Lichts zu verändern scheinen. Ranunkeln, die Boten, dass der Winter nun langsam sein kaltes Gesicht verlieren wird. Zeit der Erneuerung, in der das Leben aus der kalten Umarmung des Winters auftaucht. In vielerlei Hinsicht scheint mir die Ranunkel wie das Leben selbst. So wie die Blume aus einem kleinen Samenkorn wächst, so beginnt auch das Leben als zerbrechliche Idee, als Traum, der im Kopf Wurzeln schlägt. Es braucht Sorgfalt, Geduld und ein bisschen Glück, um diese Samen zum Blühen zu bringen. Genauso wie es Mühe und Ausdauer braucht, um unsere Träume zum Leben zu erwecken. Damit diese sogleich im nächsten Atemzug in ein Drama gezogen werden können – aus dem man wieder aufsteigt. Ich muss lachen. Ernst würde meine Gedanken wahrscheinlich übertrieben dramatisch finden. Und sie zugleich gut verstehen und stehen lassen. Ernst hat immer gut verstanden, dass wir Menschen komplex und kompliziert sind und es nicht nur schwarz-weiss gibt, sondern viele Schattierungen und auch Buntheit dazwischen.
Lieber Ernst, ein Drama ist auch ein Raum. Das, um die Frage deines letzten Briefes zu beantworten, wie das Leben so läuft. Ich musste an die aristotelische Beschreibung des Dramas denken, worin die Einheit des Raumes beschrieben wird. Der Ort der Handlung wechselt dort nicht. Man kann also sagen, Ort der Handlung meines Dramas der vergangenen Zeit spielt sich als Raum in meinem eigenen Körper ab. Auch meine Seele ist in diesem Raum. Nun, es ist wohl auch der einzige Raum, den ich mir in Zürich derzeit leisten kann. Ja, Ernst, auch ein Drama muss man sich leisten können. So stört ein Drama doch auch die geschaffene Illusion unserer Realität. Als ich vor einiger Zeit nach einem Telefonat mit meinem Hämatologen den Hörer auflegte – ich erinnere mich noch genau, die Aussicht aus dem Fenster, oben in Clavadel, die Berge in Nebel gehüllt, als wollten sie verschleiern, was ich noch nicht sehen sollte. Der Geruch nach Sterillium in der Rehaklinik und das zuverlässige Schnarchen meiner Zimmernachbarin – da war mir klar, was mir Schwierigkeiten bereitet hatte: das immer wieder kommende Fieber, die Gewichtsabnahme, die Taubheit in Fingern und Füssen, die Schmerzen, die Müdigkeit. Eine seltene und nicht heilbare Neoplasie, in den USA auch als «rare blood cancer» deklariert, kam zu Besuch und wollte meinen Körper nicht mehr verlassen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, was genau auf mich zukommt – doch in all den Gefühlen von Müdigkeit Angst vor Verlust meiner Autonomie, so, als würde ich in einer Sackgasse feststecken, war auch Erleichterung. Endlich eine Diagnose, dank meiner neuen Hausärztin und dem Hämatologen, der diagnostisch alle Puzzleteile zusammenfügen konnte und die richtigen Untersuchungen anordnete. Einen Tag nach dieser Diagnose bestellte ich mir für die Wochen meines Aufenthaltes in der Klinik wöchentlich einen Strauss Ranunkeln. Sie erinnerten mich daran, dass wir Teil eines Kreislaufs sind und wir nicht getrennt von der Welt um uns herum existieren. Und ich betrachtete ihr wöchentliches Sterben in der Vase neben mir und freute mich, dass ich noch da war.
Nun ist einige Zeit vergangen und ich lebe mit dem Damoklesschwert über meinem Kopf. Der Mensch ist anpassungsfähig, und so habe ich mich – mit mal mehr mal weniger Erfolg – der Situation angepasst. Ich erinnere mich an deine damalige Aussage in einem anderen Gespräch, dass du intellektuell pessimistisch, dem Leben zugewandt jedoch optimistisch seist. Und ich schließe mich dem an. Mein Körper ist Kriegsgebiet, ist unter Anspannung, unter Schmerzen und auch unter Überwachung, um zu verhindern, dass etwas Schlimmes passiert. Manchmal empfinde ich ihn als fremd, entfremde mich ihm. Will nicht berührt werden. Gleichzeitig ist er Lustgebiet, Objekt der Begierde, begierig nach Berührung, bewegt sich, umarmt, tanzt und streckt sich nach Leben.
Die Krux ist, dass ein Leben MIT Krebs in der Gesellschaft nicht vorstellbar scheint – entweder man hat zu sterben, zumindest sterbenskrank auszusehen, so, dass Akzeptanz herrscht oder man hat sich inTherapien zu befinden – aber bitte schön nicht fröhlich durch die Gegend tänzeln. Nein also, wo kämen wir da hin? Ich erinnere mich, wie ich einer Bekannten von meiner Schneeschuhtour erzählte (es war meine erste in den Schweizer Bergen und meine liebe Freundin Cate hat mich als Unterstützung und als Lehrerin begleitet). Keine Frage folgte, wie es gewesen sei, sondern: «Dann hast du keinen Krebs mehr?» In den onkologischen Gruppentreffen, an denen Patientinnen und Patienten mit verschiedensten Krebserkrankungen teilnehmen, erzählen fast alle Ähnliches. Bei den Genesenen ist das Fatale, dass erwartet wird, dass sie wieder agieren wie VOR ihrer Erkrankung. Die Wahrheit ist aber, dass wir nicht mehr dieselben sind. Es verändert dich. Es bodigt dich. Es ist eine Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit, ob du hinsehen willst oder nicht. Es trifft die Menschen in der Umgebung in ihrer Komfortzone und nicht wenige nehmen Abstand. Bitte keine Zumutung für andere sein – sich nicht zumuten? Entschuldigung, die anderen sind für mich auch manchmal eine Zumutung. Ich sehe dich bei diesem Satz schmunzeln Ernst, weiß ich doch, dass auch du die anderen manchmal für eine Zumutung hältst. Und einen gewissen Abstand suchst.
Abstand. Wenn man nun einige Zeit damit lebt wie ich und es mit Abstand betrachtet (soweit das mit dem eigenen Körper möglich ist), habe ich jedoch auch entdeckt, was die Krankheit mir gegeben hat. Ich meine nicht das Geplänkel von «Alles geschieht aus einem Grunde …» Diese Aussage ist mir zuwider. Als der Sohn meiner Freundin starb und man diesen Satz hört von jemandem, möchte man demjenigen am liebsten eine runterhauen. Welchen Sinn und Trost soll es geben als Mutter, als Eltern, sein Kind zu verlieren?
Mir hat die Erkrankung auch Mut gegeben. Ich verschwende nicht mehr so viel meiner Lebenszeit mit Menschen, denen ich nichts zu sagen habe und die nur Energiefresser sind. Mut, mehr auf meinem Weg zu sein und Mitgefühl mit mir zu haben, mich nicht immer durch das Leben zu peitschen, sondern auch innezuhalten und mich umzusehen. Mag der Weg das Ziel sein. Es steht recht Interessantes am Wegesrand, lieber Ernst.
In Freundschaft, Deine Mathilda